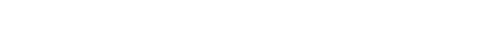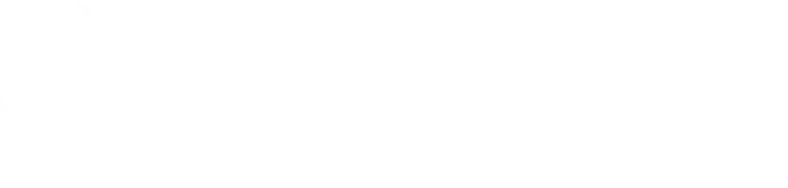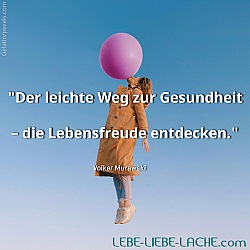ANZEIGE
Mozart - das Genie und die Heilkraft seiner Musik
Er scheint in der gesamten Kultur unserer Welt so lebendig wie nie zuvor! Elvis lebt, Wolfgang Amadeus erst recht! Kein Musiker vor Elvis wurde so sehr zur Pop-Ikone erhoben wie der bleiche, schmächtige Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus („Amadé“) Mozart (27.01.1756 bis 05.12.1791). Mit acht Jahren begeisterte er halb Europa als Wunderkind am Piano, mit vierzehn wurde er als begnadeter Komponist gefeiert, dem die genialen Einfälle vom Himmel zu zuströmen schienen.
Leben und Werk

Das alles ist so gut erforscht, es gibt so viele öffentlich zugängliche Zeitdokumente, Briefwechsel, Zeitungskritiken, Aussagen von Zeitgenossen, da müsste sich eigentlich ein einheitliches, klares und lückenloses Bild ergeben.
Und doch streben die Auffassungen der Forscher, die sich mit Mozart befassten, bis heute weit auseinander. Allein über die Ursache seines frühen Todes gibt es über 200 verschiedene Theorien.
Hier soll es um die heilende Wirkung seiner Musik gehen
Nein, weil wir den Gesamtzusammenhang nie vollständig erfassen können und deshalb auf Mutmaßungen angewiesen sind. Und Nein, weil gerade bei Mozart die Musik wie bei keinem anderen berühmten Komponisten wie eine ganz eigene Schiene neben oder über seinem tatsächlichen Leben mit all den emotionalen Höhen und Tiefen verläuft.
Er schuf begeisternde Werke wie die „Missa Solemnis“ (KV 337) in nachweisbar seelischen und sozialen Tiefs, und tiefernste, abgründige Werke wie die Sinfonie in g-moll (KV 183) ohne Anzeichen von Krise auf der biografischen Ebene.

Das Geheimnis der Musik
Wie kann jemand mit elf Jahren bereits 50 herausragende Musikwerke, darunter Symphonien, Konzerte, Sonaten und geistliche Werke geschrieben haben? Das war damals und ist bis heute eine Sensation und ein Rätsel. Und wie lässig genial Mozart seine seinerzeit viel berühmteren Kollegen, etwa den Klaviervirtuosen Muzio Clementi oder den Komponisten Antonio Salieri überflügelt und weit in den Schatten stellt! Im Film „Amadeus“ von Milos Forman ist das mitreißend dargestellt. Man möchte aufspringen und rufen: „Bravo Amadeus!“
Doch was macht seine Musik so außergewöhnlich? Was unterscheidet sie von anderen Werken seiner Epoche, der Klassik, wo es klare kompositorische Regeln der Form und der Harmonien gab und die romantische Idee des Genies noch unbekannt war?

© klimkin/pixabay
„Mozart hat eigentlich nirgendwo etwas völlig neu erfunden“, meint der Musikwissenschaftler Ulrich Konrad.
„Dafür fand er innerhalb des Üblichen erstaunliche Kombinationen und setzte sie so passgenau ein, dass es für die Zeit einzigartig, ja nicht selten unerhört klingt.“
Mozart beschrieb sein Ideal ganz einfach so: „Das Mittelding – das Wahre in allen Sachen.“ Es bedeutet nichts Geringeres, als die Mitte von allem zu finden. Ausgleich, Harmonie, Schönheit.
Mozart selbst hat wohl kaum an eine „Heilwirkung“ seiner Musik gedacht. Die Kombination von Musik und Gesundheit war zu seiner Zeit nicht populär – auf die Kulturgeschichte insgesamt bezogen eher eine Ausnahme. Fast immer, von den Schamanen der Urzeit über die alten Hochkulturen in China, Indien, Ägypten, Griechenland oder Amerika bis hin zum Mittelalter hatte Musik vor allem der Gesundheit und dem sozialen Wohl bzw. der Religion zu dienen.
Unterhaltungs- und ästhetische Werte standen hinten an. Mozart komponierte aber Auftragswerke von Adligen. Die Musik sollte deren Prestige dienen, sie sollte unterhalten oder fromm-loyal stimmen. Oft genug komponierte er quer gegen die Vorstellungen seiner Auftraggeber, doch der Erfolg gab ihm Recht.
In Europa wechselten bis heute immer schneller die Stilepochen: Romantik, Impressionismus, Expressionismus, Moderne…und nun sind wir wieder an einem Punkt angelangt, wo Musik (und Kunst allgemein) zunehmend an ihrem Wert für unsere Gesundheit und unser seelisches und soziales Wohlbefinden bewertet, d.h. auch gekauft wird. Und siehe da: Mozart steht mit an erster Stelle!

Am Erstaunlichsten ist wohl die Wirkung seiner Musik auf das Gehirn. Die Nervenzellen werden angeregt, viele neue Verbindungen zu knüpfen. Gehirnforscher nennen das „Plastizität“. Sie entspricht einer erhöhten Lern- und Konzentrationsfähigkeit. Wer Mozart hört, entwickelt demnach mehr Intelligenz. Und das betrifft alle menschlichen Entwicklungsphasen, vom Embryo bis ins hohe Alter. All dies sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie sind zum großen Teil den Forschungen eines Mannes zu verdanken.
Die Tomatis-Methode
Der HNO-Arzt und Chirurg Alfred Tomatis (1920 - 2001) war einer der innovativsten und effektivsten Erforscher des Hörens. Hunderte von Tomatis-Instituten therapieren heute nach seiner Methode weltweit eine erstaunlich umfangreiche Palette von Problemen, die alle mit Störungen im Hörsinn und den damit verbundenen Gehirnregionen zu tun haben. Eine der Grundmethoden besteht darin, dass der „Patient“ über spezielle Kopfhörer Musik hört, bei der tiefe Frequenzen herausgefiltert sind.

Wie kam Tomatis auf diese Methode? Durch die erstaunliche Entdeckung, dass bereits der Embryo im Mutterleib hört. Das war vor über fünfzig Jahren in der Fachwelt eine unerhörte Behauptung. Man ging damals von der Theorie aus, dass wir nur über die Ohren hören. Schallwellen werden über die Luft vom Ohr aufgenommen und im Innenohr weiterverarbeitet. Doch Tomatis konnte nachweisen, dass wir zu einem erheblichen Teil auch über die Vibration der Knochen hören.
Der heute weltberühmte Gérard Dépardieu verzweifelte als junger Schauspieler an seiner stockenden, holprigen Stimme und Konzentrationsschwäche. Er ging deshalb zu dem damals schon berühmten Arzt in Behandlung.
Es stellte sich bald heraus, dass Dépardieu auf dem rechten Ohr nur sehr undifferenziert und verzerrt (viel zu laut) hörte. Dieser Hörschaden, nicht zuletzt bedingt durch eine unglückliche Kindheit in schwierigen Familienverhältnissen, hatte sich auf seine Stimme und auch nervlich ausgewirkt. „Muss ich operiert werden, Medikamente nehmen?“ „Nichts dergleichen“ schmunzelte Tomatis. „Nur Mozart hören!“ Nach einigen Monaten Horchtraining waren die Schäden behoben. Depardieu sprach frei und fließend, mit klarer ruhiger Stimme, selbstbewusst und sympathisch zugleich.
Der Mozart-Effekt
Ende der 90er Jahre landete der Komponist und Musikpsychologe Don Campbell in den USA mit „The Mozart Effect“ (Deutscher Buchtitel: „Die Heilkraft der Musik“) einen Beststeller. Das Buch basiert auf den Erkenntnissen von Alfred Tomatis und löste eine wahre Flut neuer Vereins- und Institutsgründungen aus.
Schon in den 80er-Jahren hatte Prof. Joachim-Ernst Berendt als geistiger Vater mit Büchern wie „Nada Brahma“ die Arbeit von Tomatis in Deutschland bekannt gemacht.
Tomatis bescheinigt der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart die besten Therapieerfolge, ob in Tokio, Kapstadt oder Amazonien. Mozart wirke „mit einer Wucht, die andere nicht haben. Er übt einen befreienden, anregenden und ich möchte sogar sagen heilsamen Einfluss aus, der ihn selbst noch unter den Hervorragenden hervorragen lässt. Seine Wirksamkeit übertrifft bei weitem das, was wir bei seinen Vorgängern…Zeitgenossen oder Nachfolgern finden.“

Etliche Wissenschaftler, die im Bereich Klangforschung, Hörpsychologie, Neurologie etc. arbeiten, bestätigen, dass einige Merkmale von Mozarts Musik anregend auf unsere Intelligenz und Kreativität und den entsprechenden Gehirnregionen wirken: Die spielerisch fließenden Melodien, die klare Struktur der Form oder der bevorzugte Einsatz heller Klänge (Flöten, Violinen) – aber vor allem die rhythmische Variabilität der Musik Mozarts seien hierfür verantwortlich.
Effekte von Musik in der Chirurgie
Dr. Conrad erforscht in seinen Untersuchungen die Wirkung von Musik, speziell von Mozartscher Musik im Operationssaal und auf der Intensivstation. „Ich würde Musik in der Medizin mental in die gleiche Schublade geben, wie ein Medikament: Musik hat Wirkung und Nebenwirkung!“, sagt der Chirurg Dr. Conrad.

Dr. Conrad stellt beispielhaft in seinem Vortrag zwei seiner wissenschaftliche Studien vor: Die eine zur Wirkung von Musik auf Intensivpatienten, die andere zur Wirkung von Musik auf die operativen Fähigkeiten von Chirurgen.
Ein erstaunlicher Effekt – nicht nur der Musik von Mozart – auf das Gehirn ist die Anregung vieler neuer Kontakte zwischen den Neuronen. Diese Synapsen lassen ein enorm effektives Netzwerk im Gehirn entstehen. Konkret bedeutet das für uns: Höhere Konzentrations-, Lern- und Entscheidungsfähigkeit, mehr Intuition, Wachheit und Kreativität. Der amerikanische Psychologe und Komponist Joshua Leeds, Mitentwickler von „The Listening Program®“, bringt es auf den Punkt: Klang ist für das Nervensystem ebenso wichtig wie Nahrung für den Körper.
In einer Studie fanden Frances H. Rauscher und seine Kollegen an der Universität Kalifornien in Irvine heraus, dass sich die 36 Teilnehmer eines räumlichen IQ-Tests um etliche Punkte verbessern konnten, nachdem sie zehn Minuten lang Mozarts D-Dur Sonate für zwei Klaviere (KV 448) gehört hatten.

Das war 1993 und löste gleichsam über Nacht den „Mozart-Effekt“-Boom aus. Der den Versuch begleitende theoretische Physiker Gordon Shaw meinte dazu: „Mozartmusik kann das Gehirn ‚aufwärmen'. Wir vermuten, dass differenzierte Musik komplexe Denkvorgänge erleichtert, wie sie bei geistiger Schwerarbeit zum Beispiel in der Mathematik oder im Schach gefordert sind.“
Warum wirkt diese Musik entspannend auf uns?
- langsames Tempo (70-80 Schläge pro Minute, angenehme Herzfrequenz)
- symmetrische Struktur
- ruhige Dynamik
- Wiederholung von einfachen Themen
- Wiederholung durch subtile Variationen in Harmonie, Rhythmus und Tonlage
- Ideale Lände (6-8 min
Die wissenschaftliche Studie Dr. Conrads hat bestätigt, dass durch die Beschallung des Patienten mit dieser Musik folgende Körperfunktionen positiv beeinflusst werden:
- Herzfrequenz
- Blutdruck
- Narkosemittelbedarf
- Sedierungstiefe
Inzwischen hat der an der Salzburger Universität Mozarteum forschende Professor Dr. Hans-Ullrich Balzer mit chronobiologischen Analysen nachgewiesen, dass es beim Hören von Mozarts Musik zu einer erstaunlich schnellen Synchronisation mit den körpereigenen Rhythmen kommt.
Da die Steuerung der Rhythmen über Prozesse erfolgt, die im Gehirn stattfinden, stehen Balzers Beobachtung auch im Zusammenhang mit der Entdeckung Wolf Singers, des berühmten deutschen Hirnforschers, der herausfand, dass das Gehirn in einer rhythmischen Taktung arbeitet und wie ein Orchester funktioniert.
Mozarts Musik fördert unser Potential, unsere geistig-seelische Entwicklung – und das nachweislich besser als etwa laute Rockmusik.

Bei „Heavy Metall“ wenden sie sich ab. Doch wir sind keine Pflanzen. Auch aggressive, laute Musik kann therapeutisch eingesetzt werden. Und: Musik hat viele Ebenen. Eine davon betrifft unsere Gesundheit. Ästhetik und Erkenntnis sind wieder andere Bereiche. Sie sind miteinander verbunden, sollten aber auch unterschieden werden. Wer Mozart oder andere Musik nur unter dem Aspekt der Gesundheit hört, blendet vieles aus.
„Musik muss allzeit Musik bleiben“ sagte Mozart. Sie steht für sich als ein eigenes Geheimnis mit unerschöpflichem Potential.
Dies bedeutet nicht, dass nicht auch Bach, Vivaldi oder Musik des US-amerikanischen Rappers 50 Cent positiv auf Patienten wirken können. Aber in dem Fall, dass man nicht weiß, welche Musik der Patient gerne hört bzw. welche Musikrichtung ihm vertraut ist, sind langsame Sonatensätze von W. A. Mozart – wie es Dr. Conrad ausdrückt – der „kleinste gemeinsame Nenner“.
Frühgeborene gedeihen besser mit Mozart-Sonaten
Für die Entwicklung und Gesundheit von Frühchen ist es entscheidend, dass sie schnell ein bestimmtes Körpergewicht erreichen. Israelische Forscher haben nun erstmals untersucht, wie sich klassische Musik von Mozart auf verschiedene Körpervorgänge der Neugeborenen auswirkt: Die Ergebnisse sind eindeutig.

© PublicDomainPictures/pixabay
Frühchen verbrauchen weniger Energie und nehmen schneller zu, wenn sie 30 Minuten am Tag Mozart hören. Das haben israelische Forscher in einer Untersuchung herausgefunden.
Dies mache die Babys robuster und schütze sie vor Infektionen und Entwicklungsstörungen, berichten die Forscher um Dror Mandel vom Tel Aviv Medical Center in Tel Aviv in der Januar-Ausgabe des Fachmagazins „Pediatrics“.
Hans-Ulrich Teubner (Autor)
Heilsame Klänge mit Mozart Bach und Beethoven.
Therapeutische und spirituelle Elemente in der klassischen Musik
Therapeutische und spirituelle Elemente in der klassischen Musik
Quellen:
Vortrag von Dr. Dr. Claudius Conrad über Musik in der Chirurgie
- http://www.welt.de/gesundheit/article5780278/Fruehgeborene-gedeihen-besser-mit-Mozart-Sonaten.html
- http://www.christian-salvesen.de/artikel_mozarteffekt.html
Magst Du, was wir bei LEBE-LIEBE-LACHE schreiben? Willst Du uns helfen, Menschen zu erreichen, denen das auch gefallen könnte? Wie? Ganz einfach: "teilen". Wir freuen uns sehr über Deine Wertschätzung.
ANZEIGE
Weitere Artikel:

Von innen strahlen: Ernährungstipps für mehr Energie und Lebensfreude

Gelassen durch den Alltag: Entspannung will gelernt sein

Frühlingsfrisch statt Frühlingstief mit natürlichen Produkten von Sonnentor

So gesund ist Bockshornklee

Brahmi – ayurvedisches Superfood für mehr Konzentration

Tipps für mehr Entspannung im Alltag

Was ist Gesundheit?

Buchtipp & Verlosung: Der "Body Code"

Das Boudoir - Vom Schmollwinkel zur Machtzentrale

Für mehr Ausgeglichenheit sorgen: Mit regelmäßigem Sport

Gewichtszunahme – alles hormonell bedingt?

Eat your way to happiness: Warum eine nährstoffreiche Ernährung letztendlich auch der Psyche zugutekommt

Wege aus der Angst - Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther

Mondäne Atmosphäre im Grand Hotel Cesenatico

5 Wege, wie Buddhisten mit Wut umgehen

Vera Apel-Jösch: "Es macht mich traurig und wütend, dass wir so viele Mitmenschen sprachlich aussperren. "

Solarleuchten - mit der natürlichen Kraft der Sonne den Garten beleuchten

Wie du mehr Schwung in dein Sexleben bringen kannst.
Lebe-Liebe-Lache.com
ANZEIGE
Neueste Artikel:
Unsere Autoren
Unsere TOP Hotel-Empfehlungen
Diese Hotels haben wir für Sie besucht
Nicht verpassen: